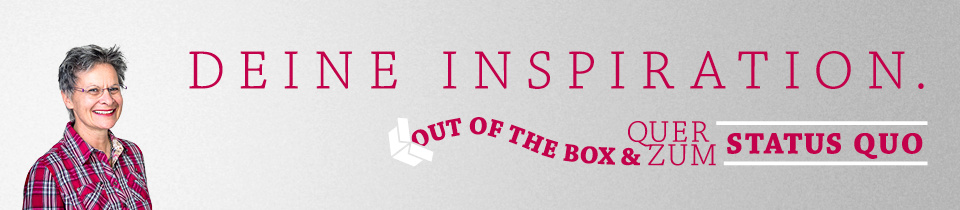Gärtnern ist gut für die Seele
5 Aspekte, unseren Garten zu kultivieren
Es liegt auf der Hand, dass der Garten eine therapeutische Wirkung zeigt. Nicht nur bei alten Menschen, die ihr Leben lang im Garten ihr eigenes Gemüse anpflanzen, sondern auch in der jungen Generation. Das Gärtnern boomt.
1. Organisiertes Urban Gardening
In urbanen Räumen werden brachliegende Flächen zum gemeinschaftlichen Gärtnern genutzt. Auf diese Weise treffen sich vorher wildfremde Menschen und werden Freunde. Wer neu in eine Gegend zugezogen ist, findet so Anschluss an die neue Nachbarschaft. Es ist organisiertes „Urban Gardening“. Besonders für jene junge Menschen, die in Blockwohnungen aufgewachsen sind, gibt das Hilfestellung, was wann kultiviert werden kann und soll. Unter Anleitung Erfahrener lernt man Blumen und Pflanzen kennen – eine Bereicherung des Lebens mit allen Sinnen.
2. Kultivieren entschleunigt
Seit dieser Pandemie und ihrer hervorgerufenen Angst und einer ungewissen Zukunft, gibt Gartenarbeit eine Perspektive. Etwas zu säen bedeutet, hoffnungsvoll nach vorne zu blicken und zugleich etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Denn das Kultivieren des Erdbodens entschleunigt. Es erinnert uns daran, dass Wachstum nicht machbar ist. Während täglich gegossen wird, hier und da, das Unkraut gejätet wird, bleibt nichts anderes als Warten.
3. Der Stresspegel wird reguliert
Gartenarbeit beeinflusst unseren Stresspegel. Sie ist gut für unser seelisches Gleichgewicht. Hier geschehen Dinge auf mehreren Ebenen. Einerseits sind die Aktivitäten, die wir im Garten ausführen von innen heraus achtsam: Wir fokussieren uns auf das, was direkt vor uns liegt, arbeiten mit den Händen – so wie beim Kochen auch. Und bei all diesen Tätigkeiten müssen wir uns auf das konzentrieren, was wir machen, wodurch es leichter funktioniert in einen Flow zu geraden. Die britische Psychiaterin Sue Stuart-Smith hat die heilende Wirkung des Gärtnerns in ihrem Buch „Vom Wachsen und Werden: Wie wir beim Gärtnern zu uns finden“ beschrieben. Auf diese Weise entspannen wir uns mental, so dass Ideen an die Oberfläche steigen können, die vielleicht schon eine Weise im Unterbewusstsein vorhanden waren. Oder wir bringen Gedanken in einen neuen Zusammenhang. Je mehr wir etwas mit unseren Händen und unserem Körper tun, desto freier wird der Kopf, um Gedanken und Gefühle zu sortieren und zu verarbeiten.
4. Garten oder Wald?
Der Unterschied zu einem Spaziergang im Wald liegt darin, dass der Garten uns eine sichere und überschaubare Umgebung bietet. Man fühlt sich behütet. Als Jäger und Sammler musste man früher immer auf der Hut sein. Deshalb ist im Wald auch heute noch ein Teil des Gehirns in den Alarmmodus versetzt. Im Garten ist dieser komplett ausgeschaltet. Ummauerte Gärten sind deshalb regelrecht therapeutisch, weil wir auf alle möglichen Arten physisch geschützt sind.
5. Das unperfekte Leben lernen
Der Garten verbindet uns auch mit dem unperfekten Leben. Nicht alles gedeiht. Es lehrt, die Außenfaktoren zu akzeptieren. Angefangen von Wind und Wetter bis hin zu den Vögeln, die den Samen picken bis hin zu den Schnecken, die sich im Salat vergnügen. Manche Pflanzen blühen, manche sterben – nicht alles läuft wie geplant. Das allein anzuerkennen ist heilsam. Und dann trotzdem anzupflanzen, zu giessen, zu düngen und das Unkraut zu entfernen – das baut eine besondere Resilienz. Es stärkt die Entschlossenheit: Und dennoch!
Nicht zuletzt lehrt uns das Gärtnern eine andere Auffassung von Zeit und erinnert uns immer wieder daran, uns auch in anderen Bereichen des Lebens, um den eigenen Garten zu kümmern und ohne auf den des Nachbarn zu schielen.
Viel Spass im Garten!

Elke Pfitzer