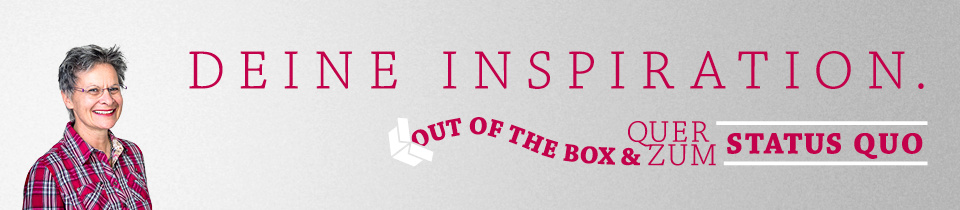Jedes Jahr wird gesät
Zur Herausforderung der Gleichheit in unserem sozialen Gefüge

Als Menschen sind wir aufeinander angewiesen. Die einen erklären es mit der Evolution, in der der Mensch in Gruppen gelebt hat und es deshalb wichtig war, dazuzugehören. Es war für das Überleben existenziell. Noch bei den Griechen war das so. Außerhalb der Polis gab es kein Überleben.
Andere nehmen das christliche Menschenbild zur Grundlage und kommen aufgrund des dreieinigen Gottes, der in sich Gemeinschaft ist, auf dasselbe Ergebnis. Die Soziologie bestätigt: Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wie auch immer: Feststeht, dass wir Menschen für Gemeinschaft gemacht sind. Allerdings ist genau dieser Aspekt des Menschseins sehr umkämpft. Das zeigt nicht allein die steigende Trennungs- und Scheidungsrate in unserer Gesellschaft, sondern auch Aufstände und Unruhen nach Verstößen gegen die Menschlichkeit.
Ein Leben in Gemeinschaft setzt die Gleichheit aller Menschen voraus. Wenn sich jemand hervorhebt, dann entsteht Hierarchie. Sie ist zwar der Gegenpol zur Anarchie, aber wir spüren, dass es etwas Dazwischen geben muss.
In Asien habe ich es erlebt, dass alle ständig daran sind, sich selbst in die hierarchische Gesellschaft einzuordnen. Ganz gemäss Konfuzius. Sogar noch die Beziehung unter Freunden wird dem Alter entsprechend gestaffelt. Jeder fragt sich, bin ich Herrscher oder Untertan. Was ist meine Rolle und mein Beitrag in der Gesellschaft? Diese Definition gibt Sicherheit und Stabilität im asiatischen Gemeinschaftsgefüge.
Bisweilen dachte ich, es wäre in Europa, dem christlichen Abendland anders. Nicht zuletzt hat die französische Revolution doch die Egalité ausgerufen und Karl Marx sie versucht wirtschaftlich durchzusetzen. Aber schon in George Orwells „Animal Farm“ von 1945 steht der Satz: „Alle sind gleich und manche sind gleicher.“ Ist diese Gleichheit also nur Wunschdenken? Traum?
Irgendwie will im Westen doch jeder irgendwie die Karriereleiter erklimmen. Selbst in Vereinen ist das Gerangel nach Position, Titel und vor allem Anerkennung festzustellen. In diesem Sinne gleichen sich die östliche und westliche Kultur immer mehr einander an. Schleichend, fast unbemerkt.
Erst an diesem Pfingstwochenende fiel mir das auf, als ich eine wohltuende andere Erfahrung machte: Wir waren vier alleinlebende Frauen zwischen Mitte dreißig und Mitte fünfzig. Wir trafen uns an drei Abenden, um einem Programm auf dem Internet zu folgen, gestalteten das Rahmenprogramm mit Essen und Spielen. Am dritten Tag war uns klar, dass wir dies bald wieder einmal machen wollten. War es das Erlebnis der Gleichheit? Da war keinerlei Gedanke an Kategorien oder die Frage, welche Position nehme ich innerhalb dieser Gemeinschaft ein. Irgendwie unbeschreiblich: Wir waren einfach, jeder sich selbst. In Frieden. Jeden Abend an einem anderen Ort. Wir zelebrierten das Leben. Sassen, assen und redeten. Und je länger das dauerte, desto tiefer wurde das Gemeinschaftserlebnis. Fast ein Stück Himmel auf Erden.
Keine Hierarchie, kein Gerangel um Positionen, kein Zurschaustellen der eigenen Leistung – einfach „Peace“. Es war das Erleben echter Geschwisterlichkeit. Keiner belehrt den anderen und doch lernen alle voneinander. Die Persönlichkeit und das Sein des anderen beeindruckt und prägt das Miteinander – auch ohne Worte. Es ist tatsächlich die innere Substanz, die in einem sozialen Gefüge zutage tritt. Gesellschaftlich ernten wir im Moment, was wir gesät haben. Allerdings wurde vergessen, dass die gute Saat jedes Jahr neu ausgesät werden muss, um vielfache Frucht zu ernten. Das Unkraut wächst von allein. Hoffentlich ist es Weckruf dafür, dass die guten Menschen jeden Alters sich wieder als Sämann betätigen. Wie sagte doch Edmund Burke gleich: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”
Welche guten Samen streust du heute aus?
Sei ermutigt!

Elke Pfitzer